 Bericht über den Landeskongress der Serviceagentur „Ganztägig lernen“ Hessen am 8. Oktober 2015 in Frankfurt
Bericht über den Landeskongress der Serviceagentur „Ganztägig lernen“ Hessen am 8. Oktober 2015 in Frankfurt
Ein Bericht von Julia Wittenhagen
Sie fuhren Snakeboard, jonglierten und hantierten mit bunten Bechern namens Speed Stacks: Die Teilnehmerinnen und Teilnehmer des diesjährigen Landeskongresses der Serviceagentur „Ganztägig lernen“ Hessen konnten in Mini-Workshops vor der Mittagspause ihren Kreislauf mächtig in Schwung bringen und gleichzeitig Anregungen für aktive Pausen im Schulalltag mit nach Hause nehmen. Passend zum Motto „‘Und sie bewegt sich doch‘ – Bewegung in der Ganztagsschule“ hatten die Veranstalter den landesweiten Treffpunkt für Lehrkräfte, Schulleitungen, Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter von Schulträgern, Horten und Schulämtern neu „rhythmisiert“.
„Liebe Kolleginnen und Kollegen, wir haben viel erreicht in den letzten Jahren“, begrüßte Birgid Oertel vom Kultusministerium das Publikum am Morgen. „Sie alle tragen zu einem Dreiklang aus Bilden, Erziehen und Betreuen bei“, sagte sie, wobei sie im Zusammenhang mit Kindern immer Schwierigkeiten mit dem Wort Betreuung habe. „Was in der Ganztagsschule geleistet wird, ist viel viel mehr.“
Stefan Siefert, der bei der Deutschen Kinder- und Jugendstiftung in Berlin die Arbeit aller Serviceagenturen unterstützt, stellte die Ganztagsschulentwicklung in Hessen heraus: „Seit 2004 ist das Land mit der Serviceagentur „Ganztägig lernen“ dabei. Sie ist besonders gut in die Landesstrukturen eingebunden, hat frühzeitig mit dem Qualitätsrahmen gearbeitet und ihre Unterstützung beim neuen „Pakt für den Nachmittag“ ist einzigartig.“
Jürgen Wrobel von der Serviceagentur Hessen stellte seine Organisation kurz vor, die ab diesem Jahr – wie alle Serviceagenturen – von der Bundes- in die Landesförderung überführt wird und leitete über zum Hauptvortrag „Motivationsförderung in der Ganztagsschule“ von Professor Albert Ziegler von der Friedrich-Alexander-Universität Erlangen-Nürnberg.
 |
 |
 |
„Ich halte heute meinen Lieblingsvortrag, den ich natürlich auf Sie zugeschnitten habe“, motivierte dieser seine Zuhörer/-innen. „Denn viele Dinge, die wir tun, motivieren nicht, weil sie auf bestimmte Strukturen des Rezipienten stoßen.“ Dafür wolle er den Blick öffnen und auf Basis von drei Annahmen: „Es gibt keinen Motivationstank, den man vollschütten kann. Im Fokus von Motivation steht nicht die Haltung, sondern die Förderung einer konkreten Handlung. Es braucht immer Verbündete.“
In den letzten 10 bis 15 Jahren habe sich in der Motivationsforschung viel verändert, führte Ziegler aus. So sei es wichtig, auf drei Ebenen anzusetzen: der Ziel-, Handlungs- und Umweltperspektive. Wichtigste Erfolgsfaktoren für Motivation seien die Erfolgserwartung und die Anreize.
„Soll ich Fernsehen gucken oder für die Mathearbeit lernen?“, nannte er als typische Situation, in der die Leistungsmotivation der Schülerin oder des Schülers über das Handeln entscheide. Zur Erfolgserwartung der jungen Menschen könne die Lehrkraft beitragen, indem sie der Klasse deutlich mache, was sie tun müsse, um eine gute Arbeit zu schreiben.
Die Anreize für die Schülerinnen und Schüler beleuchtete Ziegler auf den genannten drei Ebenen: „Für die Zielperspektive ist es ganz wichtig, sich klar zu machen, was besser ist, wenn man sein Ziel umgesetzt hat.“ Dabei helfe gedankliche Vorbereitung, um das große Ziel in konkret messbare, zeitlich definierte Zwischenziele herunter zu brechen und kleine Rückschläge nicht auf den gesamten Weg zu beziehen. Hier könne die Lehrerin oder der Lehrer Einfluss nehmen: „Versuchen Sie, mit Eltern und Schülern konkrete Ziele zu vereinbaren.“

Die Handlungsebene stellt die Motivation vor besondere Herausforderungen, weil jede Phase, ob Abwägen, Planen, Handeln oder Bewerten die Gefahr berge, dass die Fernsehsendung dem Lernen den Rang streitig macht. „In allen Phasen gilt es, alle alternativen Ziele aus dem Feld zu schlagen.“ Daher sei die Vorbildrolle der Lehrkraft immens wichtig. Sätze wie „Jetzt kommt trockener Stoff. Aber so steht er leider im Lehrplan“, seien kontraproduktiv. „Sie dürfen sich nicht entschuldigen, für den Stoff, den sie vermitteln“, appellierte der Professor an sein Publikum. „Denn ihre Motivation ist die Obergrenze der Motivierung, die sie bei ihren Schülern erzielen können.“
Was eine Lehrkraft und ihr guter Unterricht bei Schülerinnen und Schülern alles erreichen können, dafür gebe es zwei Schulen: Die Anhänger der Entitätstheorie glaubten, dass Begabungen stabil seien. Motto: Ein junger Mensch kann gut Mathe, weil der Vater Ingenieur ist und die Schwester schon gut in dem Fach war oder er kann es eben nicht. Ziegler aber machte sich für die Modifizierbarkeitstheorie stark. Sie besagt, dass man umso begabter wird, je mehr man lernt. Indizien dafür: Der messbare IQ schwanke im Tagesverlauf um 45 Punkte. Studierende seien nach den Semesterferien und Schülerinnen und Schüler nach den großen Sommerferien dümmer als kurz davor. „Man kann intelligenter werden. Professionelle Pädagogen können die Begabung steigern. Was wir dafür brauchen, ist eine aktivere Auffassung unseres Lernpotentials“, warb Ziegler.
Als er abschließend auf die Umweltperspektive einging, zählte er dazu auch die Körperhaltung. „Wer eine High Power Pose einnimmt, schüttet weniger Kortisol aus, hat weniger Prüfungsangst.“ Hohe Räume machten kreativer, lächelnde Lehrkräfte schüfen eine freundlichere Atmosphäre – übrigens auch für sich selbst. „Schauen Sie die Umgebung an: Laden der Klassenraum, die Klassenkameraden zum Lernen ein?“, wandte er sich abschließend an die Lehrerinnen und Lehrer. Sein Vortrag kam gut an: „Ich fand ihn sehr anregend und habe für unsere Schule auch schon einen Kontakt zu Herrn Ziegler hergestellt“, sagte etwa Klaus Holl vom Goethe-Gymnasium Bensheim.
 |
 |
 |
Die folgenden acht Bewegungs- und Entspannungs-Mini-Workshops mit Titeln wie „Hallo wach!“, „Die bewegungsfördernde Vertretungstasche“ oder draußen im Hof „Jonglage, Snakeboard und vieles mehr“ fanden engagierte Mitmacher/-innen: Nach der Konzentration auf Reden und Vortrag „bieten sie letztendlich die Rhythmisierung, die wir für unsere Schüler im Ganztag zu leben versuchen,“ sagte Christine Tschainer von der Regenbogenschule in Bad Vilbel.
Auch den Nachmittag hat die Serviceagentur Hessen neu strukturiert: Statt früher zwei eineinhalbstündigen Workshops bot sie den Teilnehmerinnen und Teilnehmern diesmal eine Auswahl von neun Workshops à zwei Stunden an, um tiefer in das jeweilige Thema einsteigen zu können. Dieses Modell bewährte sich bei Themen wie Schulessen, Inklusion, Individualförderung oder Gewaltprävention, die jede Ganztagsschule beschäftigen, weil die Teilnehmenden mehr Zeit bekamen, Rahmenbedingungen zu vergleichen, Erfahrungen auszutauschen, konkrete Tipps zu geben und auch über Grenzen und Misserfolge zu sprechen. Parallel fanden im großen Saal des Dominikanerklosters drei Kurzvorträge zu den Themen Beziehungsgestaltung, digitale Lebenswelten und sexuelle Gewalt unter Gleichaltrigen statt.
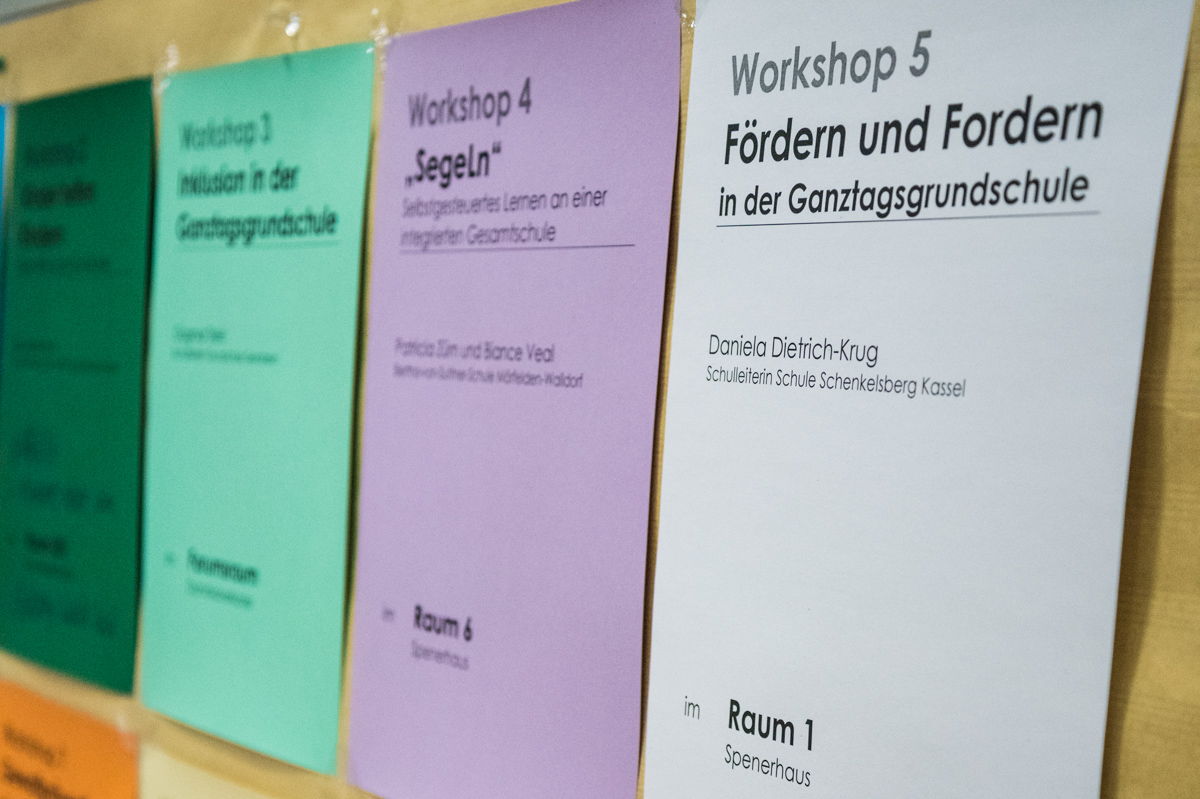
Im Workshop 3 über Inklusion berichtete Dagmar Stein von der Grundschule Geinsheim, dass ihre Schwerpunktschule baulich wie personell gute Voraussetzungen habe, auch Kinder mit Mehrfachbeeinträchtigungen aufzunehmen. „Wir haben einfach die Lehrkräfte, die sich das zutrauen, und sind offen für viele außerschulische Partner“, sagte sie. Dabei habe die Schule Zeit gebraucht, um auszuprobieren, mit welcher Stelle sie am besten zusammenarbeitet. „Wir haben unterschiedliche Kriterien für die Einstellung von Schulassistenten erarbeitet.“ Ganz wichtig dabei sei, dass der Austausch der Person möglich sei, wenn Kind und Betreuer einmal nicht harmonieren, gab sie als Erfahrung weiter. Kinder, die nicht ansprechbar seien und unter ihrer Umgebung leiden würden, nehme die Schule nicht auf, berichtete die Schulleiterin auch. „Da sind wir als Regelschule überfordert.“ Die Teilnehmenden waren bunt gemischt. Kamen vom Schulträger, Stadt und Kommune und stellten viele Fragen. „Ich dachte, wir müssten noch ganz viel lernen. Dabei machen wir schon ganz viel richtig“, freute sich ein Teilnehmer nach dem Besuch des Workshops.
Die Besucherinnen und Besucher des Workshops „Schule und Sportverein“ waren sich einig, dass die Gewinnung von Vereinsangeboten für den Nachmittag in Ganztagsschulen eine echte Herausforderung darstellt. „Dass die Übungsleiter ehrenamtlich in die Schulen gehen, wird immer seltener“, sagte der Referent Stephan Schulz-Algie, Referatsleiter Schule und Sport bei der Sportjugend Hessen. „Es ist eine Frage der Finanzierung“, sagte er und gab den Rat, noch stärker über Win-Win-Situationen nachzudenken. „Ziel der Vereine ist es, Talente aufzuspüren und Mitglieder zu gewinnen. Heben sie darauf ab. Schaffen sie Angebote für Kinder, sie sich bislang noch nicht im Verein engagieren, also eine neue Zielgruppe für den Verein darstellen.“ Aus Umfragen wisse er, dass Sportvereine zwar die wichtigsten Kooperationspartner im Ganztag seien, strukturell aber wenig involviert seien, sich in nachgeordneter Rolle sehen. „Dort müssen sie sie auch abholen.“
„Wieviel qm haben ihre Räume?“, war nur eine der vielen praktischen Fragen, die die Teilnehmerinnen und Teilnehmer des Workshops „Fordern und Fördern“ Daniela Dietrich-Krug, Schulleiterin der Grundschule Schenkelsberg in Kassel, stellten. Sie präsentierte sehr engagiert, welche Lösungen ihre Schule gefunden hat, um Schülerinnen und Schüler individualisiert zu fördern und stellte auch die Selbstlernmaterialien vor. In der Schule hat man die Schulstunden um fünf Minuten gekürzt, um den Tag mit einer Förderstunde zu beginnen, in der die Kinder nach individuellen Arbeitsplänen selbst organisiert Aufgaben lösen. Lernzeitmappen geben sie nicht nach einer Woche ab, sondern wenn sie fertig sind. Zusammen gelernt wird oft am runden Tisch. „Drei Jahre nach der Einführung stellen Lehrer und Eltern fest, dass die Kinder besser geworden sind. Dazu tragen natürlich auch Förderangebote wie Lesecafés im Ganztag bei“, sagte sie. Mehrere Teilnehmende lobten den Workshop: „Man kann sich einen Punkt herausnehmen wie zum Beispiel das Förderband und strickt ihn nach den eigenen Ressourcen weiter“, sagte eine Lehrerin.
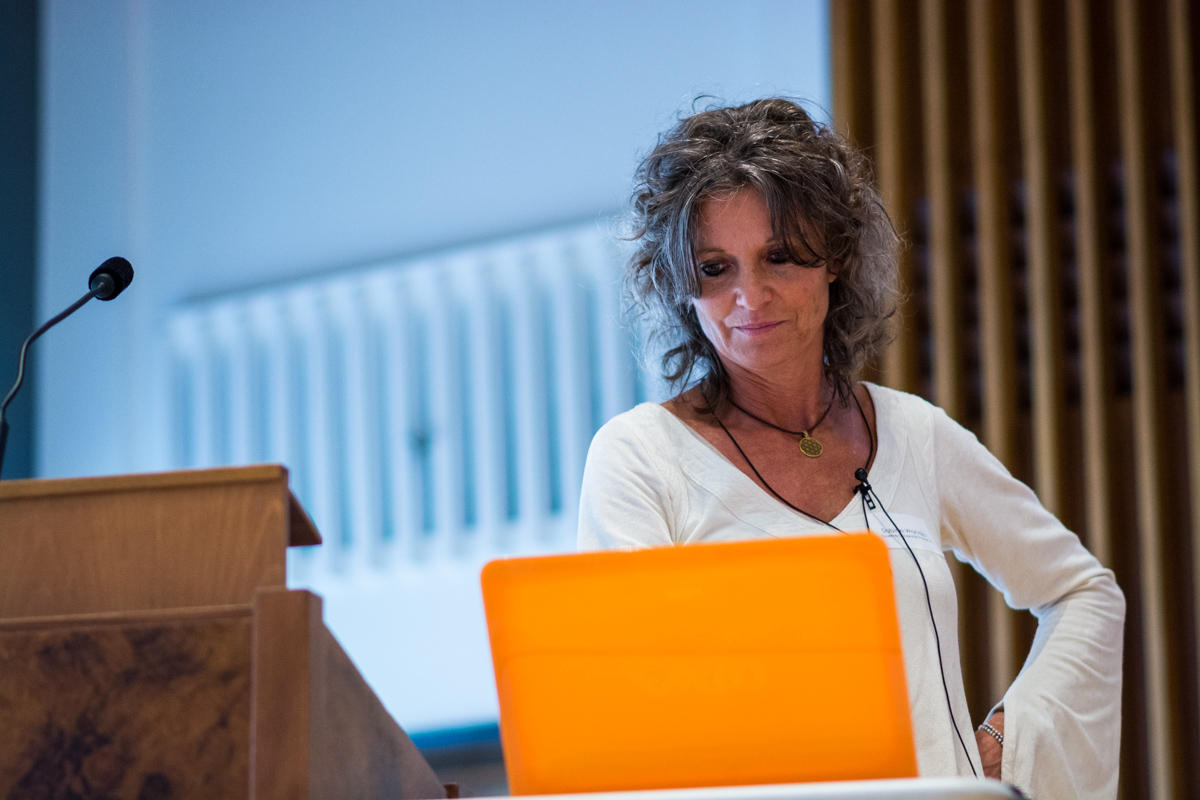 |
 |
 |
Während in den Workshops so manche Diskussion stattfand, erläuterte der Medienberater und Sozialpädagoge Thomas Gudella aus Baunatal in seinem halbstündigen Kurzvortrag, wie Kinder und Jugendliche digitale Medien nutzen und welche Herausforderungen sich dafür für den pädagogischen Alltag ergeben. „Als Eltern bringt man den Kindern Fahrrad fahren bei. Aber mit dem Smartphone lassen wir sie alleine“, kritisierte er. Grund sei möglicherweise die eigene Unsicherheit der Erwachsenen im Umgang mit den Geräten und Plattformen. „Dabei ist es an vielen Stellen nur eine Frage der Haltung“, machte er deutlich mit Blick auf Mädchen, die freizügige Bilder auf Instagram veröffentlichen und plötzlich 1.000 Follower haben. Man müsse nicht technische Kniffe beherrschen, um Jugendlichen deutlich zu machen, wie sehr sie sich damit öffentlich zur Schau stellen. „Nach meiner Erfahrung wollen Kinder Informationen über die Fallstricke des Internet haben“, sagte er.
Im Folgevortrag über sexuelle Gewalt unter Gleichaltrigen sagte die Referentin, ihr Thema liege möglicherweise quer zu den positiven Themen des Landeskongresses. Bewegen müsse sich aber auch in ihrem Bereich eine Menge, da die Fallzahlen sexuell belästigter Schülerinnen und Schüler durch ihre Peergroup steigen und gleichzeitig die Bedeutung der Schule als soziale Arena durch die Entwicklung hin zur Ganztagsschule wächst.
Den Abschluss des Tages bildete der Gallery Walk, bei dem die Teilnehmerinnen und Teilnehmer Gelegenheit hatten, alle Referentinnen und Referenten des Tages noch einmal auf ihre Belange anzusprechen. „Die neue Struktur des Landeskongresses gefiel mir sehr gut, weil sie unsere Rhythmisierung in der Schule widerspiegelt. Ich hatte einen guten und produktiven Austausch. Der Vortrag von Professor Ziegler hat mich bereichert“, zog Dennis Piechota von der Bonifatiusschule in Frankfurt Resümee.
„Besonders spannend fand ich, dass die Uhren in unterschiedlichen Teilen Hessens anders ticken je nach Schulträger und finanziellen Mitteln“, sagte Andreas Hilmes vom Schulamt Bebra. „So etwas erfährt man im Austausch hier.“
Autorin: Julia Wittenhagen
Fotos: Fabian Wanisch, Serviceagentur "Ganztägig lernen" Hessen
Datum: 12.10.2015
© www.hessen.ganztaegig-lernen.de
